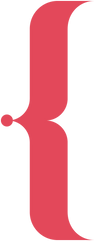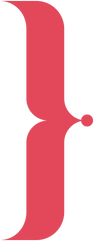Frauen
im Bergbau
die ganze Familie!
Die Industrialisierung im
19. Jahrhundert
-
Kinderarbeit und Vorschriften: Die Altersgrenze wurde auf 12 Jahre angehoben, die Höchstarbeitszeit auf zehn Stunden begrenzt.
-
Probleme der Durchsetzung: Trotz der Vorschriften arbeiteten 1883 im preußischen Bergbau weiterhin 9381 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren.
-
Kinderarbeit im Bergbau: Aufgrund ihrer geringen Größe konnten Kinder bestimmte Aufgaben wie das Bedienen von Wettertüren besser als Erwachsene ausführen. Häufig waren sie auch als Schlepper oder Pferdejungen im Einsatz.
Haus Meyer Bergmann und Anbauer
Wennigsen Ahlerstraße 5 1902
Siedlungshäuser für die Bergarbeiterfamilien
-
Bau und Finanzierung: Mit günstigen Krediten wurden die Bergarbeiterhäuser gebaut.
-
Gärten und Ställe: Obst- und Gemüsegärten sowie Ställe für Kleintiere wie Schweine, Ziegen, Kaninchen und Hühner waren direkt an den Häusern angelegt.
-
Eigenversorgung: Diese Maßnahmen waren entscheidend für die Selbstversorgung der oft kinderreichen Familien.
.
Bergarbeiterfamilie
Sie haben eine Wohnung und kein Heim, sie haben Kinder und sind keine Mütter, sie haben Lebensunterhalt und kein Leben.
Zitat von H. Oberwinter zur soziologischen Untersuchung über die Lebensbedingungen von Arbeiterinnen um 1900
Die Eigenversorgung der Bergarbeiterfamilien hat vor Not und bitterer Armut bewahrt, als die Jahreseinkommen von 836 Mark im Jahre 1874
auf 437 Mark im Jahre 1879 gesunken waren.
Familie
Im ländlichen Raum haben die Bergarbeiterfamilien oft in eigenen landwirtschaftlich geprägten Häusern gewohnt. Die soziale Lage der Familien verbesserte sich nur durch die Bewirtschaftung eines Gartens, eines gepachteten Ackers und durch Kleintierhaltung.
Zur Aufbesserung des Familieneinkommens wurden einige Frauen trotz der anstrengenden Hausarbeit auch in der Förderung und Kohlenwäsche eingesetzt .
Bergarbeiterfamilie
Arbeiterfamilien bewohnten Ende des 19. Jahrhunderts üblicherweise Wohnung, die aus: Küche, Stube und einer nicht beheizbaren Kammer bestanden. In der Küche, dem oft einzig beheizbaren Raum, wurde gekocht, gespielt, gegessen, gelernt, gewaschen und gearbeitet- und häufig auch geschlafen.
-
Alle Mitglieder der Bergarbeiterfamilien mussten zum Lebensunterhalt beitragen.
-
Kinder arbeiteten direkt nach der Schule, und Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren durften nicht länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden.
Die Jungbergleute waren dem Risiko eines vorzeitigen gewaltsamen Todes doppelt so hoch ausgesetzt wie gleichaltrige Arbeiter in der Landwirtschaft oder Maschinenbau.
Neben Ortskenntnissen war ein wesentliches Moment für die Sicherheit unter Tage die Erfahrung in der bergmännischen Tätigkeit
Eine Ausbildung, die etwa arbeitsrechtlich fixiert worden wäre , gab es im Bergbau erst nach den 1. Weltkrieg. Bergmannsarbeit basiert auf Erfahrungswissen. Die jungendlichen Arbeiter unter Tage fingen in der Regel als Schlepper an und konnten über den Lehrhauer zum regulären Kohlenhauer hocharbeiten. In der Kameradschaft " vor Ort " angeführt von den "Ortsältesten" , erwarben die Jungen nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten des Berufes, sondern bekamen auch die lebenswichtigen Verhaltensregeln und Sicherheitsvorkehrungen vermittelt
( Weber 1978 )
Bergarbeiterfamilie
Die Mehrgenerationenfamilie im eigenen Haus war insbesondere in Krisenzeiten ein stabilisierendes Moment. Das gesamte Familienleben, Wohnen, Essen und Kindererziehung spielten sich zeitweise in drei Generationen in denselben Räumen, vorwiegend Küche und Diele ab. Die Mitarbeit der Frauen war entscheidend, um große Geldsorgen abzuwenden.
Es wurde bei den Bauern während der Erntezeit gearbeitet und Produkte aus dem eigenen Garten auf den Markt ( z.B. Hannover Klagesmarkt ) verkauft. Der Anbau in den eigenen Gärten diente nicht nur der Nebeneinkunft, sondern hauptsächlich der Selbstversorgung. Gemüse, Kartoffeln und Getreide wurde auf dem von der Klosterkammer gepachteten Land angebaut. In den Kleinviehställen am Wohnhaus wurden Ziegen, Schweine , Hühner und Kaninchen gehalten. Die Eigenproduktion von Lebensmittel war sehr wichtig , um auch in den Krisenzeiten die Familie zu ernähren. Bei der Garten - und Feldarbeit mussten die Männer nach der Schicht ihre Frauen unterstützen. Zu den Bergarbeiterfamilien kamen durch die Zuwanderung von neuen Bergarbeitern auch Kostgänger hinzu.